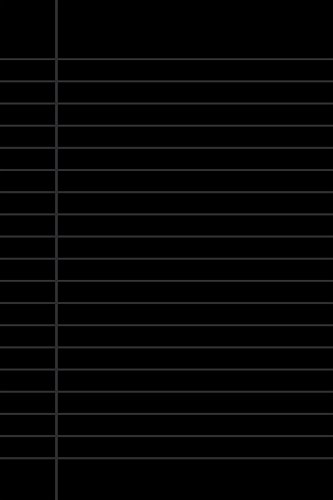
75 Prozent der Menschen sterben im Krankenhaus oder Heim, nur etwa 20 Prozent tatsächlich zu Hause. Wenn man solche Statistiken liest, fragt man sich unweigerlich: Wo werde ich sein, wenn ich sterbe? Werde ich es schaffen, zu diesen 20 % zu gehören? Ist mein soziales Netz dicht, sodass es hält und mich trägt? Werden meine Angehörigen und Freunde mir beistehen und wissen, wie ich es möchte? Was mir gut tut?
Dazu ein lesenswerter Artikel einer Notaufnahmeschwester, den ich als sehr wertvoll geschrieben empfinde?! Den Artikel lesen...
Am Ende wird zum Thema auch eine Geschichte aus dem Buch "Tausend Tode schreiben" veröffentlicht. Den Text dieser Geschichte stelle ich hier ein, weil er in einer Art vom Sterben erzählt, die einen mitfühlen lässt ohne die Person gekannt zu haben. Hier der Text:
ZitatAlles anzeigen
Sie hat es geschafft, sagt Papa am anderen Ende der Leitung, endlich hat sie Ruhe, endlich. Ich komme sofort, sage ich, natürlich. Als ich 60 Kilometer später das Zimmer betrete, liegt sie da in ihrem Bett wie ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen, so klein, so durchsichtig irgendwie, aber so friedlich: Oma.
An jeder Bettseite einer ihrer Söhne, jeder hält eine Hand. Winzig, viel zu dünn ihre Finger in den großen Männerpranken, aber wie immer knallrot lackierte Nägel, das war ihr wichtig. Vorsichtig legt Papa ihre Hand auf der Decke ab, um mich fest in den Arm zu nehmen und mit mir zu weinen.
Er ist kein Mann, der sich seiner Tränen schämt. Scheiße. Es ist traurig, dass sie weg ist, nie wieder Rommé nie wieder schwäbische Küche nie wieder ihr helles Lachen über schlüpfrige Witze. Aber es ist auch gut, für sie selbst am besten, irgendwann gab es gegen die Schmerzen nur noch diesen Weg.
Wie war es?, frage ich, wie ist es gewesen?
Papa holt tief Luft, schaut seinen Bruder an, schaut mich an und erzählt. Schlimm war es, sagt er, zuerst sehr schlimm, sie hat arg geklammert am Leben. Immer wieder entsetzliche Atemnot, das war krass, jedes Mal überlegst du, ob es noch sinnvoll ist, und dann greifst du doch wieder nach der Sauerstoffmaske. Dieser Scheißkrebs.
Liebevoll streichelt er die kleine, leblose Hand. Dann kam der Punkt, sagt er, wo klar war, jetzt passiert es. Aber es war okay, sogar höchste Zeit, und der Zeitpunkt war gut, denn wir waren beide da und das hat sie sich doch gewünscht. Vor ihrem letzten Atemzug hat sie erst M., dann mich noch einmal so angeschaut, wie nur eine Mama ihre Kinder anschauen kann, und hat ihre letzte Kraft in diese Hände hier gesteckt und ganz fest gedrückt.
Pfiats eich, meine Buam, hat sie gesagt, und dann war es einfach vorbei und es war gut.
Jetzt weinen wir wieder, alle drei, ich knie mich neben das Bett und streichle ihr kühles Gesicht, das gleichzeitig so vertraut und so fremd ist. Servus, kleine Oma, sage ich leise, und danke für alles, für stundenlange Spiele und die allerschönsten Ferien und diese kleinen Füße, die ich auch habe und die besten Kässpatzen auf der Welt und dass du mir beigebracht hast, wie man unsichtbar Socken stopft.
Noch heute ist Omas hölzerner Stopfpilz einer meiner größten Schätze. Von allem, was ich erbte, ist er mir am wertvollsten und der Grund dafür, dass ich über jeden Kinder-Socken-Kartoffelzeh schmunzeln muss und mich auf die Arbeit daran freue, statt mich zu ärgern, genau, wie ich das bei so vielen kleinen Dingen mache,über die ich mich ebenso gut furchtbar aufregen könnte.
Danke, Oma.
Quelle: Textzicke - Tausend Tode schreiben

